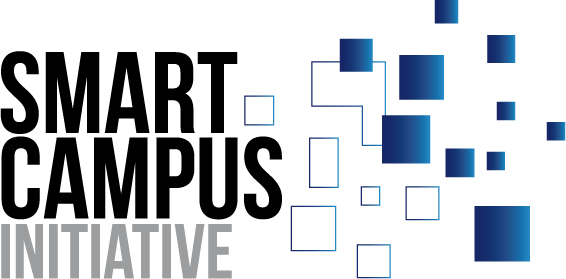Ko-kreative Entwicklung von smarten Services
Damit smarte Services den größtmöglichen Nutzen für den Campus bringen, verwenden wir Methoden der ko-kreativen Dienstleistungsentwicklung. Dies bedeutet, dass wir potenzielle Nutzende am Bildungscampus (z. B. Studierende und Mitarbeitende) direkt in den Entwicklungsprozess einbeziehen und sie dabei in den Mittelpunkt stellen.
Wir leiten unser Vorgehen von dem Referenzmodell für die Entwicklung Kognitiver Dienstleistungssysteme ab. Der Service-Innovationsprozess gliedert sich in sechs Phasen: Problemverständnis, Ideenfindung, Konzeption, Gestaltung, Evaluation und Roll-Out. Die sechs Entwicklungsphasen sind nicht streng voneinander getrennt: Sie können zeitliche und methodische Überschneidungen haben und werden bei Bedarf wiederholt. Dadurch kann kontinuierlich auf sich verändernde Trends und Anforderungen reagiert werden. Wie das Modell in der Praxis aussehen kann, erklären wir in unserem Whitepaper, das hier gratis heruntergeladen werden kann. Unten erklären wir die einzelnen Schritte.
1. Problemverständnis
Ermittlung der Bedarfslage relevanter Akteursgruppen

In einem ersten Schritt identifizieren wir die Herausforderungen und Probleme der Campus-Akteure im Hinblick auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen vor Ort. Dies kann auf direktem Wege über Beschwerden und Anfragen an das Campus-Management geschehen oder mithilfe von Umfragen, Studien und Workshops. Anschließend erfolgt eine Einschätzung, inwiefern die genannten Herausforderungen mithilfe von smarten Services bearbeitet werden können. Dabei beurteilen wir die Realisierbarkeit, den Mehrwert für den Bildungscampus, den Umsetzungsaufwand, das Budget und das benötigte Personal.
2. Ideenfindung
Ko-kreative Ideengewinnung und -priorisierung
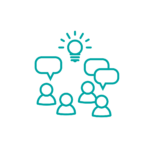
Im nächsten Schritt legen wir den Fokus auf die gemeinsame Entwicklung von Ideen für smarte Services. Dabei kommen Kreativmethoden zum Einsatz, die wir mit den künftigen Nutzenden in einem moderierten Prozess durchführen. Nach der Sammlung der Ideen erfolgt eine Bewertung, um festzustellen, welche Ideen realistisch umsetzbar sind und Mehrwerte für die Nutzenden und den Campus bieten könnten. Anschließend priorisieren wir die Ideen, um zu bestimmen, welche von diesen weiterverfolgt werden sollten.
3. Konzeption
Konzeption der Service-Prototypen

Basierend auf den zuvor entwickelten Ideen skizzieren wir Konzepte smarter Services für den Bildungscampus in einem höheren Detailgrad. Ziel der Phase ist es, die konzeptionelle Idee zu veranschaulichen und wichtige Funktionalitäten des Service zu konkretisieren. Die Ergebnisse davon können verschiedene festgehaltene Konzepte oder sehr rudimentäre Mock-Ups sein. In dieser Phase wenden wir kollaborative, offene und kreative Methoden an, um die Zusammenarbeit und den Ideenaustausch zu fördern.
4. Gestaltung
Umsetzung und Test der Service-Prototypen

In dieser Phase setzen wir die Service-Prototypen um und testen sie unter realen Bedingungen. Dabei können beispielsweise Interfaces, Apps, Webanwendungen oder physische Hardware entwickelt werden. Tests mit den künftigen Nutzenden ermöglichen ein schnelles Feedback, sodass der Service in mehreren Iterationsschritten weiter verbessert werden kann. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, den Prototypen kontinuierlich anzupassen und auf die Bedürfnisse der Nutzenden zuzuschneiden.
5. Evaluation
Validierung der Service-Prototypen

In enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erarbeiten wir Möglichkeiten zur Implementierung des Service-Prototyps in den operativen Betrieb. Dabei berücksichtigen wir die Erfahrungen aus den vorangegangenen Phasen. In mehreren Schritten leiten wir notwendige Handlungsmaßnahmen ab und ermitteln den personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand. Auf diese Art und Weise prüfen wir die Skalierbarkeit des Prototyps, um sicherzustellen, dass er effektiv implementiert werden kann. Die Smart Campus Initiative hat dabei den Anspruch, den gesamten Prozess bis zur Validierung der Service-Prototypen zu begleiten. Wenn sich diese als vielversprechend erweist, erfolgt eine Bewertung im Hinblick auf den Roll-Out.
6. Roll-Out
Übergabe des Service-Prototypen
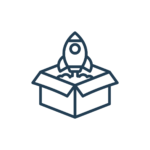
In der Roll-Out-Phase findet die Übergabe an das Campus- Management und die beteiligten Partner statt. Diese Phase markiert den Übergang von der experimentellen Entwicklungsphase zur praktischen Anwendung im täglichen Campusbetrieb. Die Verantwortung für die Weiterentwicklung und dauerhafte Integration des Dienstes geht von der Smart Campus Initiative an das Campus-Management und/oder externe Partner über. Um eine reibungslose Übernahme und Nutzung des Services zu gewährleisten, implementieren wir zusätzlich regelmäßige Feedbackschleifen mit Nutzenden und technischen Teams. Nach erfolgreicher Optimierung wird der Service schrittweise auf weitere Bereiche des Campus für eine umfassende Nutzung ausgeweitet.