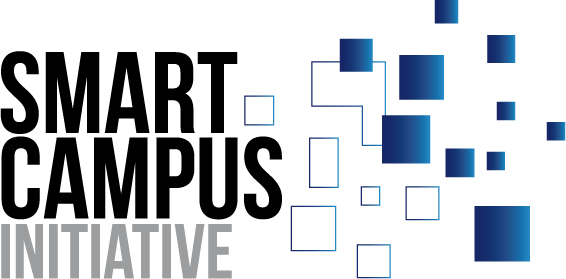Projekt Telemedizin
Begleitforschung zur Akzeptanz eines telemedizinischen Angebots

© Fraunhofer IAO

© Fraunhofer IAO
Ausgangsituation und Projektziel
Digitale Sprechstunden werden bereits von vielen Arztpraxen angeboten und erleichtern den Zugang zu medizinischer Beratung. Patientinnen und Patienten können sich beispielsweise über das Smartphone einwählen, werden per Video mit Ärztinnen und Ärzten verbunden und können unabhängig von ihrem Aufenthaltsort mit ihnen sprechen. Allerdings sind auf diesem Weg medizinische Untersuchungen bisher nur eingeschränkt möglich. Hier setzen Telemedizinboxen an: Sie bieten einen sicheren Zugang zur digitalen Sprechstunde und sind mit medizinischen Geräten ausgestattet. Je nach Ausstattung der Boxen können unterschiedliche Leistungen angeboten werden (z. B. Beratung über Diagnostik, Blutdruckmessung, EKG oder Ultraschall, bis hin zu therapeutischen Maßnahmen).
Auf dem Bildungscampus wird das telemedizinische Angebot der care.box im Rahmen eines Forschungsprojekts untersucht. Dabei stellen sich im Projekt folgende Forschungsfragen: Wie gelingt der erfolgreiche Einsatz dieser Telemedizinboxen? Welche Formen der Interaktion zwischen Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten sind zielführend? Unter welchen Rahmenbedingungen werden solche Lösungen akzeptiert und nachhaltig genutzt?
Lösungsansatz und der Beitrag für den Campus
Das Fraunhofer IAO beteiligt sich an dem Projekt im Rahmen einer begleitenden Akzeptanzuntersuchung. Es wird zunächst eine standardisierte Befragung von Patientinnen und Patienten, die das telemedizinische Angebot bereits genutzt haben, durchgeführt. Ziel ist es, die Akzeptanz der care.box aus Anwendersicht zu erfassen. Die eingesetzten Fragebogen-Items orientieren sich dabei an bewährten Technologieakzeptanzmodellen, die unter anderem Dimensionen wie wahrgenommenen Nutzen, Bedienfreundlichkeit und Vertrauen abbilden.
Auf Basis dieser quantitativen Ergebnisse findet im nächsten Schritt ein vertiefender Workshop mit einer Teilgruppe der Befragten statt. Hier werden zentrale Befunde diskutiert, die zugrundeliegenden Motive hinterfragt und mögliche Barrieren oder zusätzliche Mehrwerte identifiziert. Besonderes Augenmerk gilt
- dem Ablauf der Interaktion (z. B. Terminbuchung, Gesprächsführung, Verbindung mit Ärztinnen und Ärzten),
- der Ausstattung der care.box (aktuell reine Videosprechstunde, Perspektive auf zusätzliche Diagnosegeräte),
- den wahrgenommenen Risiken (z. B. Datensicherheit, Hygienestandards) sowie
- emotionalen Faktoren (z. B. Vertrauen und Wohlbefinden während des Aufenthalts).
Durch die Kombination aus Umfrage und Workshop lässt sich besser verstehen, wie die Telemedizinbox von den Patientinnen und Patienten angenommen wird und wie das Angebot so gestaltet werden kann, dass es ihren Bedürfnissen möglichst gut entspricht.
Übertragbarkeit der Lösung
Die Forschungsergebnisse lassen sich auf unterschiedlichste Digital-Health-Projekte übertragen: Von betrieblichen Gesundheitsangeboten bis hin zu Pop-up-Stationen telemedizinischer Angebote im öffentlichen Raum. Sie bieten damit eine praxisnahe Grundlage für die Akzeptanzförderung dieser Angebote.
Laufzeit
August 2025 – Dezember 2025
Anwendungsfelder
Betriebe
Ländlicher Raum
Katastrophen-
schutz